Techno Scapes
■ DATUM:
■ ORT:
■ KONZEPT UND REALISATION:
■ KÜNSTLERINNEN:
■ DISPLAY:
■ TECHNISCHE KONZEPTION UND UMSETZUNG DES DISPLAY:
■ PROGRAMMIERUNG WEB INTERFACE:
■ UNTERSTÜZUNG:















TECHNO SCAPES
Es gibt viele beeindruckende Bilder von der Landschaft des Salzkammerguts: Aufnahmen von glasklaren Seen, schneebedeckten Bergrücken und üppigen Wiesen wandern tagtäglich über Handy-Screens. Wie entstehen diese Bilder und wo werden sie gespeichert? Wie erreichen sie uns? Techno Scapes geht von Natur-Bildern aus und fragt nach den materiellen Bedingungen dieser scheinbar körperlosen und ätherischen Abbildungen. Das Projekt macht jene Orte und Infrastrukturen sichtbar, die der Speicherung und Verbreitung dieser Bilder zugrunde liegen. The Golden Pixel Cooperative erforscht die unsichtbaren Landschaften, die hinter, über und unter realen Landschaften liegen.
Technologische Neuerungen verändern die menschlichen Sehgewohnheiten. So stand zum Beispiel die Entwicklung des Kinos mit seinen bewegten Bildern und Blicken zu Beginn des 20. Jahrhunderts in enger Verbindung mit dem Hinausschauen aus der fahrenden Eisenbahn. Wie beeinflusst das Smartphone unseren Blick auf Landschaften?
Am Grundstück des Hotel Lueg, einem ehemaligen Bahnhof, treffen sich unsichtbare Datenleitungen und die verschwundenen Schienen der 1957 stillgelegten Salzkammergut-Lokalbahn. Hier installiert die Kooperative ein mobiles Kino, in dem fünf Videoarbeiten präsentiert werden. In einem speziell konzipierten Setting werden die Handy-Screens der Besucher*innen zur Leinwand, auf der Filme zu sehen sind. Wie lose verbundene Episoden greifen die fünf Arbeiten die ökologische Dimension der Datenübertragung bzw. -speicherung aus menschlichen und mehr-als-menschlichen Perspektiven auf. Alle fünf Videoinstallationen wurden zwischen Sommer 2020 und Frühling 2021 eigens für Supergau realisiert.
Der emotionale Gehalt und die vermeintliche Echtheit von Natur-Bildern steht im Zentrum von Simona Obholzers digital generiertem Video. Lisa Truttmann stellt in ihrer Videoarbeit eine Verbindung zwischen der ehemaligen Zugstrecke der Ischler Bahn und zeitgenössischen Mobilfunktechnologien her. Die Landschaften im Inneren eines Smartphones – die Leitungen zwischen den Teilen und die Rohstoffe, aus denen diese Geräte zusammengebaut werden – stehen im Zentrum von Katharina Swobodas Beitrag. Marlies Pöschl entwirft eine Alternative zu gegenwärtigen Datenzentren: Speicherung in der DNA von Pflanzen. So gelangen unerwartete Bilder nach St. Gilgen – Arbeiterinnen aus einer chinesischen Elektrofabrik wandern über die Luegerstraße. Die Lebensräume von Tieren, als Landschaften, die oft zu wenig wahrgenommen werden, stellt Nathalie Koger ins Zentrum ihres Beitrags. Zusammen mit einer Gruppe von Kindern erzählt sie Erich Kästners Konferenz der Tiere neu. Albino-Tiere kritisieren als Stellvertreter für alle Tiere die existenzbedrohenden Eingriffe der Spezies Mensch in ihren Lebensraum.



DISPLAY
Smartphones sind integrativer Bestandteil beim Erleben der uns umgebenden Landschaft. Sie sind ein portabler Screen, der sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum präsent ist. Sie ersetzen Land- und Wanderkarten, sind meteorologische Auskunft-Geber, scannen und benennen Flora und Fauna. Nicht zuletzt ersetzen sie den Fotoapparat bzw. die Filmkamera. Technologische Devices wie das Smartphone formen unseren Blick auf Landschaft. Das Mobiltelefon mit seinem Touch-Screen ist gegenwärtig (fast) immer dabei und so zu einer Art erweitertem Körperteil geworden.
“Screens” sind Flächen, die den physisch wahrnehmbaren Raum abschirmen und gleichzeitig wie ein Fenster den Blick in einen immateriellen virtuellen Raum freigeben. Das in Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Emanuel Ehgartner entwickelte Display greift diese Hybridität des Screens auf. Mit dem verwendeten Lochblech entwerfen wir Flächen, die abschirmen, jedoch gleichzeitig auch durchscheinend sind. Wir laden mit unserer mobilen Kino-Installation, die aus fünf Teilen besteht, die Besuchenden ein, sich bewusst in Relation zu ihrem Smartphone, ihrem persönlichen portablen Screen, zu setzen. Jede Station wirft dabei unterschiedliche Fragestellungen auf. Der Widerspruch zwischen sichtbar Machen und Verbergen durch die Lochblech-Fläche wird in Katharina Swobodas Installation adressiert. Marlies Pöschls 360 Grad-Film mit Augmented Reality-Elementen spricht die Überschneidung von Screen und real erfahrbarer Welt an, bei Lisa Truttmann werden die Smartphones mehrerer Besucher*innen aneinandergelegt, wodurch eine größere Screen-Fläche entsteht und das singuläre Schauen in ein gemeinsames überführt wird. Simona Obholzer adressiert mit ihrer Installation den Betrachter*innenkörper als Leerstelle zwischen den Screens. Nathalie Koger stellt durch die Schnittstelle Handyscreen eine Konferenzschaltung zu den digitalen und analogen Aufenthaltsorten von Tieren her.
Auch der Faltplan ist, wie das Mobiltelefon, ein Medium, mit dem wir für gewöhnlich Natur erschließen. Dabei benötigt jedoch das Handling des Plans einen größeren Bewegungsradius als die Streich- und Tippbewegungen auf dem Smartphone und verweist somit stärker auf die Körperlichkeit der Leser*innen.



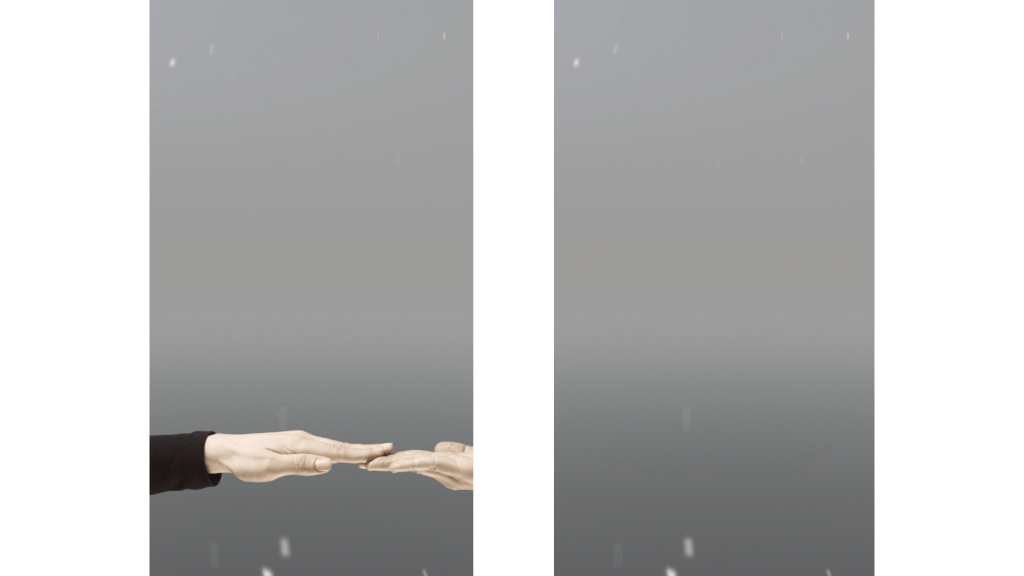






Programm
■ NATHALIE KOGER: DIE KONFERENZ DER TIERE, REVISITED. ERÖFFNUNG 1 + 2
2-teilige Videoinstallation, bestehend aus 4 Videos und Salzlecksteinen, 4K, Farbe, Live-Ton, gesamt ca. 11 min., 2021
In diesem Video sind sechs Albino-Tiere an unterschiedlichen Orten in Österreich und Deutschland zu sehen: in Zoos, Wildgehegen und sogar in einer Tierauffangstation. Die Albino-Tiere reisen in der Fiktion als Geister der Zukunft in die Gegenwart und stehen so für ein kollektives Erinnern der Gegenwart aus der Perspektive der Zukunft. Gerahmt werden diese Bilder von einem Gedicht der deutschen Kulturproduzentin und Pädagogin Marion von Osten. In Human Animal Song (2017) zählt von Osten auf was Menschen mit Tieren tun und kritisiert so die Dominanz des Menschen in Mensch-Tier-Beziehungen. Dieses Gedicht wurde von mehreren Jugendlichen eingesprochen. Sie sind Teil einer Gruppe von Schüler*innen, mit denen Nathalie Koger seit September 2020 an einer Neuinterpretation der Konferenz der Tiere von Erich Kästner zusammenarbeitet. Die Kinder repräsentieren die Zukunft, die Tiere zeigen uns die Gegenwart. Die vier hier präsentierten Videos bilden den Prolog dieses Filmprojektes.
In dem Originaltext wirken alle Tiere der Welt als Transformationsagent*innen für eine bessere Zukunft der Menschheit. “Wie kann man Die Konferenz der Tiere in die Gegenwart übertragen und mit Kindern als Film neu denken?”, fragt Nathalie Koger in diesem partizipativen künstlerischen Projekt. Entwickelt werden soll ein filmisches Märchen, in dem die Kinder – anders als in Kästners Original – als Agent*innen der Tiere auftreten.
Credits:
Regie, 2. Kamera, Schnitt, Produktion: Nathalie Koger
Kamera: Mathias Windelberg
Gedicht: Marion von Osten
Übersetzung: Ivana Milos
Colour Grading: Andreas Lautil
Beratung: Konstantin Sautier/Nymphenburger Schulen, Christine Lang
Dank an: Sabine Öfner, Rainer Zöchling, Uwe Ringelhan, Thomas Knauer und Guneet Toor, Sarah Krohnfeld, Clement King, Linus Rieger, Alexander Sentenstein, Magnus Clausing, Moritz Funk, Marina Weiß, Noah Alibaba, Luca Rupp, Eleonora Berger, Shivali Shrungarkar und Saranda Azemi, Nymphenburger Schulen
■ SIMONA OBHOLZER: PERFECT PARTICLES (X KWH)
2-Kanal Videoinstallation für zwei Mobiltelefone, Hochformat, 4K, Farbe, ohne Ton, 5 min., 2021
“Nur physikalischer Direktkontakt zwischen unserem Organismus und die sensorisch-kognitive Analyse des materiellen Kontaktes können unmissverständliche Informationen generieren, nach denen wir mit Sicherheit annehmen können, dass es eine in Relation zu unserem Körper äußere und unabhängige physikalische Umwelt gibt.“ *
Schneefall hinterlässt eine spezielle Art von Landschaft. Es legt sich eine Schicht über alles, ergibt sich eine neue Oberfläche. Eine hoch emotionalisierte Landschaft, hinter der in Zeiten der Klimaerwärmung viel Technik steckt. In Perfect Particles (x kWh) wird computergenerierte Natur herangezogen. Es fällt unaufhörlich Schnee, mal stärker, mal schwächer. Eine Hand streckt sich dem “Natur-Schauspiel” entgegen, in Erwartung eines zufälligen, flüchtigen Kontakts. Die Flocken sind jedoch digital generiert, sie haben keinen Ursprung in der materiellen Welt. Die vom so genannten Emitter ausgestoßenen Partikel hinterlassen keine Spuren auf dem Bild, dessen Teil sie geworden sind. Der physische Kontakt bleibt ein gedankliches Experiment.
Die Installation sieht das Ablegen der Mobiltelefone vor. Mit dem Freiwerden der eigenen Hände erscheinen Hände im Bildraum, die versuchen ein Sensorium im Bildraum abzurufen.
*Martin Grunwald: Haptik: Der handgreiflich‐körperliche Zugang des Menschen zur Welt und zu sich selbst. In: Thomas H. Schmitz (Hrsg.): Werkzeug‐Denkzeug. Bielefeld: Transcript Verlag, 2012, S.96.
Credits:
Konzept und Realisation: Simona Obholzer
Kamera: Michael Schindegger
Mitwirkende: Pan Selle
3D-Modelling: Thomas Welte
■ MARLIES PÖSCHL: DATA GARDEN
4-teilige ortsspezifische Videoinstallation, 360 Grad-Video, Farbe, binauraler Ton, gesamt ca. 10 min., 2021
Eine junge Wissenschaftlerin aus Guian, China, hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sie, als Alternative zu den bestehenden Datenzentren, Daten in der DNA von Pflanzen speichern kann. So gelangt eine geheimnisvolle Pflanze nach St. Gilgen, in deren DNA Informationen gesichert sind, und die den Anfang des Data Garden, einer verborgenen Bibliothek, darstellt. Die Pflanze enthält Erinnerungs-Fragmente über eine Gruppe von Wanderarbeiterinnen in einer chinesischen Elektrofabrik. Jene Menschen, die unsere Mobiltelefone zusammenbauen, tauchen auf geisterhafte Weise in St. Gilgen auf. Die Realität der Produktionsbedingungen legt sich als “Augmented Reality” über den Ort, den wir sehen.
Die Szenen basieren auf den Gedichten von Zheng Xiaoqiong, einer chinesischen Autorin, die Wanderarbeiter*innen und deren Lebens- und Arbeitsbedingungen porträtiert. So thematisiert Data Garden, wie die Auswirkungen der global ungleichen Produktionsverhältnisse sich in Pflanzen einschreiben, mit ihnen migrieren und sich im kollektiven Gedächtnis verankern.
Credits:
Regie, Schnitt, Produktion: Marlies Pöschl
Gedichte: Zheng Xiaoqiong
Übersetzung: Lea Schneider, Martin Winter
Zhou Yangchun: Daniela Chen
Voice Over: Kun Jing
Chor: Xingchen Liu, Haili Luo, Ying Qui-Zhang, Jiayi Steiner, Sissi Qi Wang, Yu Li Ya, Guanpei Zhou
Regieassistenz: Sophie Averkamp
Kamera: David Rabeder
Ton & Sounddesign: Simon Rabeder
Kostüm: sandy wetcliff vienna
Danke: Xie Feru, Felix Rank, Meni Böhm, Christof Krainthaler, Stiegl
■ KATHARINA SWOBODA: STONES
Einkanal-Videoinstallation, 4K, Farbe, Ton, 5 min., 2021
Viele Bestandteile der Bauelemente eines Smartphones werden zunächst in Form von Gesteinen mühsam aus der Erde herausgeholt, bevor sie mit thermischen und chemischen Prozessen weiterverarbeitet werden. Einige dieser groben Gesteine, aus denen Elemente wie Palladium, Tantal, Lithium oder Metalle der Seltenen Erden gewonnen werden können, werden im Video gezeigt. Eine Wissenschaftlerin untersucht diese Steine im Mikroskop und mit ihr werfen wir einen abstrahierten Blick auf die “inneren Landschaften” eines Smartphones. Das Video endet mit einem Experiment – nachdem mit den Gesteinen auf den Anfang der Rohstoffkette der Smartphones verwiesen wurde, thematisiert das Experiment das Ende der Nutzungsdauer des Geräts.
Credits:
Konzept, Regie, Produktion: Katharina Swoboda
Kamera: Sonja Vonderklamm
Sound: Sara Pinheiro
Performerin: Christine Murkovic
Danke an: Kamen Stoyanov, Iris Blauensteiner, Dr. Bernd Moser/Chefkurator Mineralogie Joanneum Graz, Dr. Michael Murkovic/TU Graz
■ LISA TRUTTMANN: TRACKS I-III
3-Kanal Videoinstallation für drei Mobiltelefone, 3 x HD, Farbe, 3 x Stereo-Ton, ca. 10 min., 2021
Als “Phantom Rides” geisterten zu Beginn der Filmgeschichte schnell vorbeiziehende Landschaftsbilder durch die ersten Kinosäle. Waren es zunächst Kameras, die auf Zügen montiert in Höchstgeschwindigkeiten vermeintlich unberührte Gebiete visuell eroberten, so sind es nun auch mobile Funksignale, die unseren technologisierten Blick steuern und Landschaftsräume mit erschließen. Tracks I-III geht auf Spurensuche und verfolgt, fragmentarisch und assoziativ, die ehemalige Teilstrecke der Ischler Bahn zwischen Mondsee und Strobl. In einer digitalen Geisterbahn der Gegenwart durchqueren wir die Landschaft, suchen nach Anhaltspunkten und blicken zugleich nach vor und zurück. Wir fragen danach, wie unsichtbare Funksignale reisen, wie sich diese in bewegten Bildern manifestieren, und warum wir jetzt auf unser Handy schauen und nicht im Kino sitzen.
Credits:
Interview mit: Alfred Wiener
Konzept, Kamera, Schnitt: Lisa Truttmann
Tonaufnahmen: Gerald Roßbacher
Drohnenpilot: Daniel Ausweger