Fussabdrücke Im Datenmeer
■ DATUM:
■ ORT:
■ KONZEPT UND REALISATION:
■ KÜNSTLERINNEN:
■ DISPLAY:
■ UNTERSTÜZUNG:
■ KURATIERT VON:








Egal was wir tun – wir hinterlassen ständig Spuren. Diese Spuren können sichtbar oder unsichtbar sein, sie können bewusst oder auch ganz zufällig entstehen. Wenn wir zum Beispiel im Schnee spazieren, dann hinterlassen wir sichtbare Fußabdrücke. Doch welche Fußspuren hinterlassen wir im Internet und wie verändern unsere Handlungen in digitalen Räumen die Landschaften und Ökosysteme, die uns umgeben? Was für Geschichten erzählen uns Tiere und Pflanzen zu diesem Thema, und haben Kinder und Jugendliche bei der Gestaltung von Klimafragen und Politik eigentlich ein Mitspracherecht? […]
Ausgangspunkt dieses Ausstellungsprojekts zum Mitmachen sind Bilder und Videos von Landschaften, Pflanzen oder von Wetterphänomenen, die die Künstlerinnen für das Supergau Festival in Salzburg produziert haben. Ständig sind wir von solchen Bildwelten umgeben: Aufnahmen von kristallklaren Seen, Fotos von Sanddünen und schneeweißen Pisten oder auch Schnappschüsse von verkehrsreichen Straßen wandern täglich über unsere Bildschirme. Doch wo leben diese Bilder und wie werden sie gespeichert? Wie erreichen sie uns und wie groß ist ihr ökologischer Fußabdruck? In dieser Ausstellung, die analoge und digitale Medien miteinander verbindet, werden gemeinsam – künstlerisch und wissenschaftlich – Entwürfe und Vorschläge für eine umweltfreundliche Zukunft entwickelt. Die Besucher*innen sind dazu eingeladen, diesen Fragen nachzugehen und auf sie zu reagieren, um so eigene Spuren in der Ausstellung zu hinterlassen. […]
„Space for Kids. Fußabdrücke im Datenmeer“ ist ein Ausstellungsprojekt, das sich mit der Erschließung und Betrachtung von Umwelten mittels digitaler Technologien beschäftigt. Ausgehend davon entwickelte The Golden Pixel Cooperative eine Ausstellungsstruktur, in der mehrere künstlerische Arbeiten – wie einzelne Kapitel – miteinander in Verbindung stehen und um ein gemeinsames Thema kreisen: In ihrem Ausstellungsbeitrag befragt Simona Obholzer die „Echtheit“ und den emotionalen Gehalt von bildlich wiedergegebenen Naturereignissen wie Schneefall. Enar de Dios Rodríguez beschäftigt sich mit künstlich gemachten Landschaften. Sie geht dabei dem unstillbaren Hunger des Menschen nach Sand nach, dem nach Wasser am meisten abgebauten natürlichen Rohstoff unseres Planeten. Lisa Truttmann erforscht Funksignale und zeigt, wie sich Technologien in jeden Winkel unserer Natur einschreiben, während Marlies Pöschl Pflanzen als Datenspeicher in den Blick nimmt. In Anlehnung an Erich Kästners Die Konferenz der Tiere und Donna Haraways Unruhig bleiben (ein Plädoyer für das „Mit-Werden“) verhandelt Nathalie Koger gemeinsam mit einer Gruppe von Kindern die existenzbedrohenden Eingriffe der Menschen in den Lebensraum anderer Lebewesen. Katharina Swoboda bringt im Internet herumstrawanzende „e-animals“ wiederum in den Karlsgarten zurück.
Zu jeder dieser künstlerischen Arbeiten gibt es im Booklet und direkt im Ausstellungsraum auch Anleitungen zum Kreativwerden und Weiterarbeiten.
Ein zentraler Teil der Space for Kids-Mitmach-Ausstellung ist die Möglichkeit für die Besucher*innen, sich auch unabhängig vom Workshop-Programm einbringen zu können. Im Raum verteilt gibt es Stationen mit Anregungen und Materialien zum selbstständigen, kreativen Weiterarbeiten. Die Kunstwerke, die von den Besucher*innen vor Ort gestaltet werden, werden zu einem Teil der Ausstellung: Jeder Beitrag erweitert sie und macht sie reicher und vielfältiger.
Passend zum Thema wuchert „Space for Kids. Fußabdrücke im Datenmeer“ nicht nur im Innenraum, sondern auch im Karlsgarten neben der kunsthalle wien am Karlsplatz. Im Garten stehen beispielsweise sehr auffällige Displays versehen mit QR-Codes, die, wenn man sie mit einem Smartphone scannt, einiges zu sagen haben.
Space for Kids. Fußabdrücke im Datenmeer fördert die Teilhabe im Bereich der Kunst und zeigt zeitgenössische künstlerische Positionen, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Anregungen für eine kritische Auseinandersetzung bieten.
Kunstvermittlungsteam der kunsthalle wien




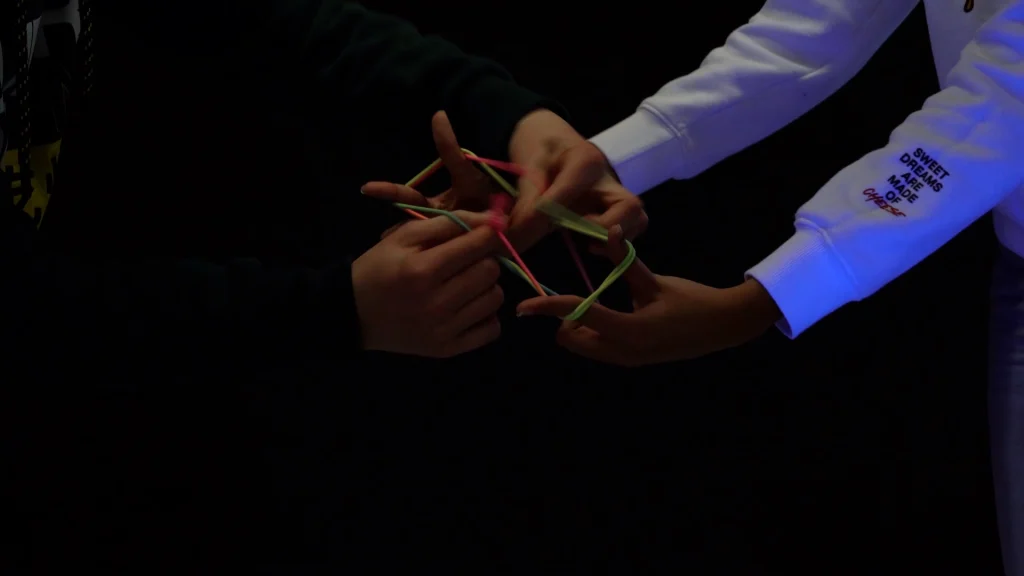


Programm
■ ENAR DE DIOS RODRÍGUEZ: VESTIGES (AN ARCHIPELAGO)
Videoessay in vier Kapiteln auf digitalen Geräten, Farbe, Ton, jedes Kapitel 10 min, 2020
Sand ist neben Luft und Wasser der wichtigste Rohstoff auf unserem Planeten. Er wird für die Herstellung von Glas, also beispielsweise für Fenster, Bildschirme oder Brillen, aber auch für Mikrochips in Computern sowie Smartphones dringend gebraucht, außerdem kommt er in Flugzeugen oder Zahnpasta und sogar in manchen Lebensmitteln zum Einsatz. Am meisten Sand fließt aber in den Bau von Straßen und Häusern. Beton, das mit Abstand beliebteste Baumaterial für Wohnungen und andere Gebäude, besteht zu zwei Dritteln aus Sand, während bloß ein Kilometer Autobahn 30.000 Tonnen davon enthält. Die immer größer werdende Nachfrage ist besonders schlecht für unsere Umwelt und bedroht viele Lebensräume auf der Erde.
Enar de Dios Rodríguez geht in ihrem Video „Vestiges (an archipelago)“ der Bedeutung und der Geschichte der Sandgewinnung auf den Grund. In ihrem Film sehen wir die Erde aus der Vogelperspektive, dadurch wird sichtbar, wie im Lauf der Zeit große Landstriche durch den Abbau von Sand verformt und das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen davon sehr stark verändert wurde. Was bedeutet es, wenn Land an einem Punkt der Erde einfach verschwindet, um daraus an einer anderen Stelle Wohnungen zu bauen?
Für diesen Film hat die Künstlerin sehr viel recherchiert, um uns einen guten Überblick über das Thema zu geben. Sie hat ihr Video in vier Kapitel geteilt: Im ersten Kapitel geht es um die Orte, an denen Sand abgebaut wird. Das nächste Kapitel beschreibt, wie der abgebaute Rohstoff über weite Strecken transportiert wird, dann sehen wir, was passiert, wenn der Sand an seinem Ziel ankommt, und schließlich lernen wir etwas über die Konsequenzen, die diese Reise für uns alle hat. In diesem Film folgen wir Sand fast rund um den ganzen Erdball und erfahren dabei vor allem sehr viel über die Menschen, die diesen bewohnen.
DREHBUCH, REGIE, SCHNITT: Enar de Dios Rodríguez
VOICEOVER: Mariah Proctor
SOUNDTRACK: NASA Space Recordings of Earth
■ NATHALIE KOGER: DIE KONFERENZ DER TIERE, REVISITED
Video, 4K, Farbe, Ton, 14 min, 2021
In diesem Video sind Kinder und Jugendliche sowie sechs Albino-Tiere zu sehen. Albino-Tiere haben wie Menschen, die Albinismus haben, eine hellere Haut-, Haar- bzw. Fellfarbe, weil die Farbstoffe nicht oder nicht so gut ausgebildet werden.
Als Ausgangspunkt dieser Arbeit dient Erich Kästners Buch „Die Konferenz der Tiere“, in dem alle Tiere der Welt, auch die Fantasietiere aus Büchern, als Agent*innen für eine bessere Zukunft der Menschheit wirken.
Die Grundidee des 72 Jahre alten Kinderbuchs wird in die Gegenwart und auf die derzeitige Situation übertragen und so zu einer Rede für die Zukunft der Tiere und der Kinder im Zeitalter des menschengemachten Klimawandels.
Die sechs Albino-Tiere sind so etwas wie Gäste aus der Zukunft: Sie erzählen uns von unserer Gegenwart und davon, dass die Lebensbedingungen in der Zukunft gänzlich andere sein können, weil es zum Beispiel durch den Klimawandel an vielen Orten viel heißer sein wird. Die Albino-Tiere leben dann als lichtempfindliche Wesen unter der Erde. In dem Video sind sie nun Botschafter*innen, sie wollen uns darauf aufmerksam machen, dass wir ständig übersehen, dass die Tiere ebenso ihren Platz auf der Erde haben wie wir Menschen. Wir aber wollen keine Wölfe in den Wäldern, keine Spinnen im Zimmer und Kühe müssen sich in engen Ställen drängen. In der Realität leben diese Albino-Tiere in Reservaten eines verstädterten Lebens: im Zoo, im Wildgehege oder einer Tierauffangstation.
Die Kinder und Jugendlichen widmen ihnen und ihrem Dasein das Gedicht „Human Animal Song“ von Marion von Osten (übersetzt als „Das Lied vom Tiermenschen“), das von Unterdrückung und Missachtung erzählt. Sie, die Kinder und Jugendlichen, treten nun – anders als in Kästners Original – als Agent*innen der Tiere auf. Die Kinder sind die Zukunft, die Tiere zeigen uns die Gegenwart.
REGIE, 2. KAMERA, SCHNITT, PRODUKTION: Nathalie Koger
KAMERA: Mathias Windelberg
GEDICHT: Marion von Osten
ÜBERSETZUNG: Ivana Milos
STIMMEN: Louisa Schloßbauer, Eleonora Berger, Guneet Toor, Saranda Azemi, Shivali Shrungarkar
SOUNDDESIGN: Sara Pinheiro
COLOUR GRADING: Andreas Lautil
BERATUNG: Konstantin Sautier/Nymphenburger Schulen, Christine Lang
DANK AN: Sabine Ofner, Rainer Zöchling, Uwe Ringelhan, Thomas Knauer und Guneet Toor, Sarah Krohnfeld, Clement King, Linus Rieger, Alexander Sentenstein, Magnus Clausing, Moritz Funk, Marina Weiß, Noah Alibaba, Luca Rupp, Nymphenburger Schulen
■ MARLIES PÖSCHL: DATA GARDEN
4-teilige ortsspezifische Videoinstallation, 360 Grad-Video, Farbe, binauraler Ton, gesamt ca. 10 min., 2021
Eine junge Wissenschaftlerin aus Guian, China, hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sie, als Alternative zu den bestehenden Datenzentren, Daten in der DNA von Pflanzen speichern kann. So gelangt eine geheimnisvolle Pflanze nach St. Gilgen, in deren DNA Informationen gesichert sind, und die den Anfang des Data Garden, einer verborgenen Bibliothek, darstellt. Die Pflanze enthält Erinnerungs-Fragmente über eine Gruppe von Wanderarbeiterinnen in einer chinesischen Elektrofabrik. Jene Menschen, die unsere Mobiltelefone zusammenbauen, tauchen auf geisterhafte Weise in St. Gilgen auf. Die Realität der Produktionsbedingungen legt sich als “Augmented Reality” über den Ort, den wir sehen.
Die Szenen basieren auf den Gedichten von Zheng Xiaoqiong, einer chinesischen Autorin, die Wanderarbeiter*innen und deren Lebens- und Arbeitsbedingungen porträtiert. So thematisiert Data Garden, wie die Auswirkungen der global ungleichen Produktionsverhältnisse sich in Pflanzen einschreiben, mit ihnen migrieren und sich im kollektiven Gedächtnis verankern.
Credits:
Regie, Schnitt, Produktion: Marlies Pöschl
Gedichte: Zheng Xiaoqiong
Übersetzung: Lea Schneider, Martin Winter
Zhou Yangchun: Daniela Chen
Voice Over: Kun Jing
Chor: Xingchen Liu, Haili Luo, Ying Qui-Zhang, Jiayi Steiner, Sissi Qi Wang, Yu Li Ya, Guanpei Zhou
Regieassistenz: Sophie Averkamp
Kamera: David Rabeder
Ton & Sounddesign: Simon Rabeder
Kostüm: sandy wetcliff vienna
Danke: Xie Feru, Felix Rank, Meni Böhm, Christof Krainthaler, Stiegl
■ KATHARINA SWOBODA: STONES
Einkanal-Videoinstallation, 4K, Farbe, Ton, 5 min., 2021
Viele Bestandteile der Bauelemente eines Smartphones werden zunächst in Form von Gesteinen mühsam aus der Erde herausgeholt, bevor sie mit thermischen und chemischen Prozessen weiterverarbeitet werden. Einige dieser groben Gesteine, aus denen Elemente wie Palladium, Tantal, Lithium oder Metalle der Seltenen Erden gewonnen werden können, werden im Video gezeigt. Eine Wissenschaftlerin untersucht diese Steine im Mikroskop und mit ihr werfen wir einen abstrahierten Blick auf die “inneren Landschaften” eines Smartphones. Das Video endet mit einem Experiment – nachdem mit den Gesteinen auf den Anfang der Rohstoffkette der Smartphones verwiesen wurde, thematisiert das Experiment das Ende der Nutzungsdauer des Geräts.
Credits:
Konzept, Regie, Produktion: Katharina Swoboda
Kamera: Sonja Vonderklamm
Sound: Sara Pinheiro
Performerin: Christine Murkovic
Danke an: Kamen Stoyanov, Iris Blauensteiner, Dr. Bernd Moser/Chefkurator Mineralogie Joanneum Graz, Dr. Michael Murkovic/TU Graz
■ LISA TRUTTMANN: TRACKS I-III
3-Kanal Videoinstallation für drei Mobiltelefone, 3 x HD, Farbe, 3 x Stereo-Ton, ca. 10 min., 2021
Als “Phantom Rides” geisterten zu Beginn der Filmgeschichte schnell vorbeiziehende Landschaftsbilder durch die ersten Kinosäle. Waren es zunächst Kameras, die auf Zügen montiert in Höchstgeschwindigkeiten vermeintlich unberührte Gebiete visuell eroberten, so sind es nun auch mobile Funksignale, die unseren technologisierten Blick steuern und Landschaftsräume mit erschließen. Tracks I-III geht auf Spurensuche und verfolgt, fragmentarisch und assoziativ, die ehemalige Teilstrecke der Ischler Bahn zwischen Mondsee und Strobl. In einer digitalen Geisterbahn der Gegenwart durchqueren wir die Landschaft, suchen nach Anhaltspunkten und blicken zugleich nach vor und zurück. Wir fragen danach, wie unsichtbare Funksignale reisen, wie sich diese in bewegten Bildern manifestieren, und warum wir jetzt auf unser Handy schauen und nicht im Kino sitzen.
Credits:
Interview mit: Alfred Wiener
Konzept, Kamera, Schnitt: Lisa Truttmann
Tonaufnahmen: Gerald Roßbacher
Drohnenpilot: Daniel Ausweger